
Bislang war Lübeck vor allem die Stadt mit dem Holstentor und dem Marzipan. Jetzt ist es auch die Stadt mit dem Doppelpunkt. Zum Jahresbeginn trat ein neuer Leitfaden in Kraft, der die Stadtverwaltung dazu anhält, anstelle von »Lübeckern und Lübeckerinnen« künftig »Lübecker:innen« zu schreiben, denn es gibt schließlich noch die Diversen, die weder das eine noch das andere sind. (Und damit sind nicht etwa die Ostholsteiner aus dem Umland gemeint, wie mancher zunächst annahm.). In Hannover hatte man sich bereits vor einem Jahr für das Sternchen entschieden, um allen Geschlechtern gerecht zu werden, in Lübeck ist es nun der Doppelpunkt geworden.
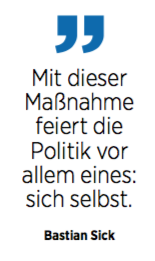
Mit dieser Maßnahme feiert die Politik vor allem eines: sich selbst. Die meisten Bürger nämlich sehen keine Notwendigkeit dafür und sind von der geschlechtergerechten Schreibweise eher befremdet. Doch alle deutschen Kommunen leisten sich inzwischen einen »Gleichstellungsbeauftragte:n«, der seine Existenz irgendwie rechtfertigen muss. Das eigentliche Ziel der Gleichstellung, nämlich die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen in gleichwertigen Positionen, wird so bald nicht erreicht werden, denn daran hat die Wirtschaft kein Interesse. Also gewährt man den Gleichstellungsbeauftragten ihre Sternchen und Doppelpunkte, damit sie wenigstens einen kleinen Erfolg für sich verbuchen können.
Dabei ignorieren die Verantwortlichen, dass sie mit diesem Leitfaden gegen ein wesentliches Regelwerk verstoßen: die amtliche deutsche Rechtschreibung. Die sieht nämlich keine Sternchen und Doppelpunkte im Wortinneren vor. Schon als Student war es mir nicht möglich, mich mit dem damals gerade in Mode gekommenen großen Binnen-I in Worten wie »StudentInnen« und »DozentInnen« anzufreunden, zumal der Duden nur eine weibliche Berufszeichnung mit großem »Innen« zuließ, und zwar die »Innenarchitektinnen«. Aber die amtlichen Regeln der Rechtschreibung scheinen unsere Politiker nicht zu kümmern.
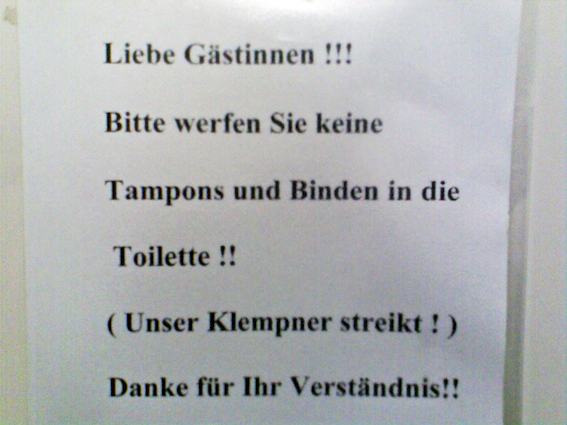
Es geht in dem neuen Leitfaden übrigens nicht allein um den Doppelpunkt: Auch zahlreiche Wörter sollen ersetzt werden, so wie das Rednerpult, das zum Redepult wird, und die Teilnehmerliste, die künftig eine Teilnahmeliste sein wird. Beide waren offenbar zu männlich-dominant. Dabei gibt es seit 2018 einen Beschluss vom Bundesgerichtshof, der die ganze Gender-Debatte eigentlich hinfällig werden lässt. Damals hatte eine Saarländerin dagegen geklagt, dass ihre Sparkasse sie als »Kunden« und »Kontoinhaber« ansprach. Sie fühlte sich benachteiligt und verlangte, als »Kundin« und »Kontoinhaberin« angesprochen zu werden. Der BGH wies die Klage ab – mit der Begründung, dass die Worte »Kunde« und »Kontoinhaber« die Frauen nicht ausschließen. Eine Benachteiligung sei nicht gegeben.
Aber auch ein BGH-Urteil scheint für die politisch motivierten Sprachveränderer heutzutage nicht mehr relevant. Mich befällt stets ein ungutes Gefühl, wenn Sprache dazu benutzt wird, um politische Interessen durchzusetzen, wenn die eine:n den ander:innen vorschreiben, was sie zu schreiben und zu denken haben. Denn das hatten wir alles schon oft genug – und es ging nie gut aus. Insofern ist dieser Lübecker Leitfaden nur ein weiterer sprachlicher Leidfaden.
Leitfaden für gendersensible Sprache bei der Hansestadt Lübeck
Artikel »Liebe Leser:innen« als PDF zum Herunterladen und Weiterverschicken
 Bastian Sick Die offizielle Website des Bestseller-Autors Bastian Sick (»Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod«) mit all seinen Texten rund um die deutsche Sprache sowie seinen Fundstücken, Quizspielen, Gedichten und Terminen.
Bastian Sick Die offizielle Website des Bestseller-Autors Bastian Sick (»Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod«) mit all seinen Texten rund um die deutsche Sprache sowie seinen Fundstücken, Quizspielen, Gedichten und Terminen.




Schon ein bisschen kurios. Ich bin ein Mensch, und der trägt auch einen maskulinen Artikel: »der«. Bin ich als Frau nun eine Menschin? Und was ist eigentlich mit einer Frauen-Mannschaft? Oder mit »seinen Mann stehen«, »einen Blaumann tragen«? – Wir legen uns selbst so viele Steine in den Weg, warum? Ich bezeichne mich übrigens selbst z. B. als Fahrradfahrer, und ich fühle mich dabei in meiner Weiblichkeit überhaupt nicht beinträchtigt.
Gibt es eigentlich männliche Gleichstellungsbeauftragte? Meines Wissens nicht. Zumindest war dies an den Unis mal verboten. An der Uni meiner Tochter machen sich die Studenten, pardon: Studierenden, über das „Hexenhaus“ der Gleichstellungsbeauftragten lustig und reagieren mehrheitlich bestenfalls genervt auf ihre kreativen Ideen.
Der ganze Wahn mag im Nominativ ja auch noch funktionieren. Die Busfahrer:innen (gern auch die Busfahrer*innen, wie bei uns vorgeschlagen) fahren Busse. Aber im Dativ können die Fahrgastierenden den Busfahrer(n) und -:innen keinen schönen Tag wünschen. Wo bleibt denn dann das Dativ-n?
Und was keine dieser Gendertanten berücksichtigt hat, ist, dass diese Sonderzeichen in der IT ein No-Go darstellen, weil sie als Feldtrennzeichen gelesen werden (können). Wer muss sich schon mit IT auskennen.
Übrigens nenne ich mich IT-Berater, weil Beraterinnen gab es mal als Avon-Beraterin. Will man/frau das?
Im Jahr 1991 gab es im Deutschen Fernsehfunk (vor seinem verordneten Ende nach Art. 36 des Einigungsvertrages) die Sendung „samstalk“ mit Olaf Henneberg, die ich sehr gerne gesehen habe. In einer Folge war Lea Rosh vom NDR zu Gast, die bereits in der Talkrunde saß, als zwei Frauen aus dem gewöhnlichen (Ex-) DDR-Volk hinzukamen. Beide sollten ihren jeweiligen Beruf nennen. Die eine erklärte, sie sei Maler, die andere stellte sich als Tischler vor. Daraufhin insistierte Frau Rosh entrüstet, es müsse doch „Malerin“ und „Tischlerin“ heißen. Die Kamera zeigte den Gesichtsausdruck der beiden Frauen. Ich konnte kaum aufhören zu lachen wegen der Mischung aus grenzenlosem Erstaunen und vollständigem Unverständnis, das darin zu lesen war. In der DDR war man mit der Gleichberechtigung wirklich schon viel weiter als im Westen – jedenfalls im Beruf. Wenn Zuhörer mit einer Berufsbezeichnung automatisch die Möglichkeit verbinden, dass der Inhaber weiblich oder männlich (oder nun auch: divers) ist, ist in Sachen Gleichberechtigung das Maximum dessen erreicht, was erreicht werden kann. Die Gender-Mode, wonach weiblich nur ist, wo „in“ dran hängt, erreicht nur das Gegenteil von Gleichberechtigung, weil der Unterschied betont wird, statt ihn zu überwinden. Dabei gibt es gerade im Deutschen nicht den geringsten Grund, vom grammatischen auf das biologische Geschlecht zu schließen. Denn es gibt kein erkennbares System für die Zuordnung des grammatischen Geschlechts. Für jedes Substantiv muss das grammatische Geschlecht mitgelernt werden. Man nehme nur das Gesicht: das Auge, die Nase, der Mund. Oder Besteck: der Löffel, die Gabel, das Messer. Die Berufsbezeichnungen spiegeln zwar tatsächlich die früheren gesellschaftlichen Verhältnisse wieder, als die Männer das Erwerbseinkommen hatten und die Frauen für Haus und Kinder zuständig waren. Aber eben wegen der Besonderheit der deutschen Grammatik lässt sich das – wie von den oben erwähnten Frauen aus der DDR für mich eindrucksvoll demonstriert – mühelos kulturell durch eine Änderung des Vorverständnisses überwinden, ohne die heute moderne Sprachverhunzung, die nicht nur viele Texte (gerade auch Gesetzestexte) erheblich verkompliziert (der Vorsitzende und sein Stellvertreter, die Vorsitzende und ihr …), sondern auch sprachliche Unterscheidungen einebnet. An den Unis sind plötzlich alle „Studierende“, auch wenn sie zwar immatrikuliert sind, aber gerade nicht studieren, weil sie z. B. in den Semesterferien arbeiten.