Ein Unglück kommt selten allein, heißt es, daher ist es nicht verwunderlich, wenn zur Entgleisung eines Zuges auch noch die Entgleisung der Sprache hinzukommt. Der stilistische Umgang mit Katastrophen kommt oft selbst einer Katastrophe gleich; Fähren, Busse und Züge voller Menschen verunglücken, die Sprache verunfallt.
Katastrophen-Journalismus ist die vielleicht älteste Form des Journalismus überhaupt. Das merkt man deutlich an seiner Sprache: Kaum ein anderes Themengebiet ist derart von redundanten Redewendungen durchsetzt, nirgendwo findet man gründlicher gedroschene Phrasen. Wenn irgendwo die Erde bebt, dann fallen Gebäude, Häuserblocks, ganze Dörfer stets „wie Kartenhäuser“ in sich zusammen. In den USA, wo die meisten Telefonleitungen noch überirdisch verlaufen, knicken die Masten bei Wirbelstürmen regelmäßig um „wie Strohhalme“. Und wenn der „Twister“, wie er neuerdings auch bei uns so gerne genannt wird, richtig gut drauf ist, dann werden Trucks, also Lastwagen, durch die Luft geschleudert „wie Spielzeugautos“.
Diese Vergleiche sind derart populär, dass sie bereits einen hohen Wiedererkennungswert haben. Sie lesen nur „Kartenhäuser“ und wissen sofort: Aha, ein Erdbeben. Allerdings muss man sich fragen, wieso angesichts von Naturkatastrophen derartige Vergleiche überhaupt nötig sind. Sie sollen die ungeheure Gewalt veranschaulichen, mit der die Natur am Werke war; tatsächlich aber werden die Kräfte der Natur durch solche Vergleiche eher verharmlost.
Ein anderes Mittel zur Beschreibung von Katastrophen ist das hastige Ausreizen von Superlativen. Das neue Jahrhundert war gerade mal lächerliche zwei Jahre alt, da wurde das Hochwasser an Elbe und Oder bereits zur „Jahrhundertflut“ erklärt. Alle Fluten, die in den nächsten 97 Jahren über deutschen Dächern zusammenschwappen, müssen sich damit abfinden, dass der Name „Jahrhundertflut“ bereits vergeben ist.
Weil vorhin von Lastwagen die Rede war: Es gibt da noch ein anderes Schwerfahrzeug, von dem man derzeit täglich liest: die Feuerwalze. Jedes Jahr stampft, donnert und rollt sie durch Europas beliebteste Ferienregionen, von der Côte d’Azur über Spanien bis nach Portugal. In ihrer irren Fahrt walzt sie nicht nur Tausende Hektar Wald nieder, sondern offensichtlich auch jede semantische Alternative. Die Feuersbrunst, der Waldbrand und das gemeine Feuer als solches sind eindeutig zu Vokabeln zweiter Wahl verkommen. Platz da für die Feuerwalze! Brände haben übrigens die bemerkenswerte Eigenschaft, immer zu „wüten“. „Auch in weiten Teilen Norditaliens wüten Brände“, liest der Nachrichtensprecher vom Blatt, und er klingt dabei gewohnt sachlich. Ein wahrhaft wagnerianisch wuchtiges Wort wie „wüten“ klingt aber geradezu grotesk, wenn es sachlich vorgelesen wird. „Lodern“ wäre auch mal ganz hübsch, aber im Journalistendeutsch können Brände nun mal nicht anders als wüten. Und ist es wirklich noch nötig, Verwüstungen immer ein „schwer“ oder „schwerst“ vorauszuschicken? Hat denn je ein Feuer, ein Sturm oder eine Flut irgendwo mal „leichte Verwüstungen“ hinterlassen?
Und dann die Opfer! Natürlich, sie stehen im Zentrum der Katastrophe, sie wollen wir sehen, möglichst geschunden, blutüberströmt, weinend, auf einer Trage liegend. Der Krieg fordert viele Opfer, und in der Regel bekommt er sie auch. Meistens handelt es sich dabei um „unschuldige Frauen und Kinder“. Männer scheinen per se schuldig, von „unschuldigen Männern“ liest man jedenfalls erschreckend selten.
Erschreckend häufig liest man hingegen Sätze wie diesen: „52 Personen wurden teilweise schwer verletzt.“ Wie sieht das wohl aus, wenn jemand „teilweise schwer verletzt“ ist? Muss man sich das so vorstellen, dass bei allen 52 Personen jeweils ein Arm oder ein Bein stark lädiert wurden, während die restlichen Körperteile mit leichten Kratzern davongekommen sind? Schon klar: Das Wort „teilweise“ bezieht sich auf die Menschen, nicht auf die Verletzungen, aber das Wort ist ungünstig platziert und sorgt für syntaktische Verwirrung.
Hartnäckig hält sich auch die Überzeugung, dass die Evakuierung von Menschen eine geeignete Maßnahme zur Verhütung von Katastrophen sei: „Die Bewohner mehrerer Berggemeinden … wurden am vergangenen Freitag evakuiert, als sich die Feuerwalze ihren Häusern mit einer Geschwindigkeit von fünf Kilometern in der Stunde genähert hatte.“ Welch grausige Vorstellung! Evakuieren bedeutet wörtlich die Luft heraussaugen, im bekannteren übertragenen Sinne: etwas leer machen. Städte, Häuser und Dörfer kann man evakuieren, aber keine Menschen. Vielleicht handelte es sich bei den Bewohnern der Bergdörfer aber auch um aufblasbare Gummipuppen. Dann nehme ich alles zurück.
Bisweilen wird den Opfern noch nachträglich übel mitgespielt. „Wieder Unfall mit einem Toten“, titelte die „Sächsische Zeitung“ im Mai. Gruselig, so was! Man kennt Unfälle mit Motorrädern, mit Rehen, mit Heißluftballons oder mit Fußgängern. Aber mit einem Toten? Dazu kann es kommen, wenn ein Leichenwagen einen offenen Sarg verliert und der Tote auf die Autobahn geschleudert wird. So etwas soll schon vorgekommen sein. Schlimm ist auch ein „Busunglück mit 13 Schwerverletzten“. Nun sind diese armen Menschen schon schwer verletzt, und dann rast auch noch ein Bus in sie hinein. Dabei hätte es gar nicht so weit zu kommen brauchen; denn es ist wie beim Backen – die Präposition „mit“ gehört vor die Zutaten, nicht vor das Resultat: „Backen mit Liebe“, nicht „Backen mit Kuchen“. Was gäbe es sonst beim „Kochen mit Biolek“?
Die schlimmste aller denkbaren Katastrophen ist übrigens die „humanitäre“. Von der hört und liest man immer wieder. Humanitär heißt „menschenfreundlich, wohltätig“. Was also haben wir uns unter einer Wohltätigkeits-Katastrophe vorzustellen? Eine Benefiz-Gala mit Dieter, Naddel & Co.? Das Leben steckt voller Gefahren, und die Sprache ist ein tückisches Terrain voller Fallgruben. Ehe man sich versieht, ist man mit ihr „verunfallt“; der Stil, teilweise schwerverletzt, wird von der Feuerwalze überrollt und unter den Trümmern von Kartenhäusern begraben. Welch eine Katastro-f-e!

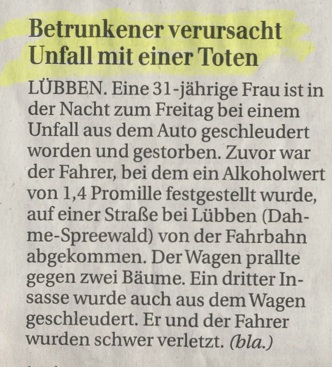
(c) Bastian Sick 2003
Diese Kolumne ist auch in Bastian Sicks Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ erschienen.
 Bastian Sick Die offizielle Website des Bestseller-Autors Bastian Sick (»Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod«) mit all seinen Texten rund um die deutsche Sprache sowie seinen Fundstücken, Quizspielen, Gedichten und Terminen.
Bastian Sick Die offizielle Website des Bestseller-Autors Bastian Sick (»Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod«) mit all seinen Texten rund um die deutsche Sprache sowie seinen Fundstücken, Quizspielen, Gedichten und Terminen.



